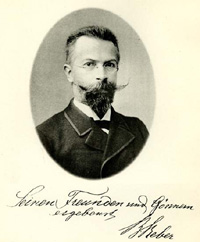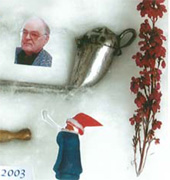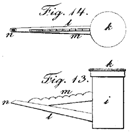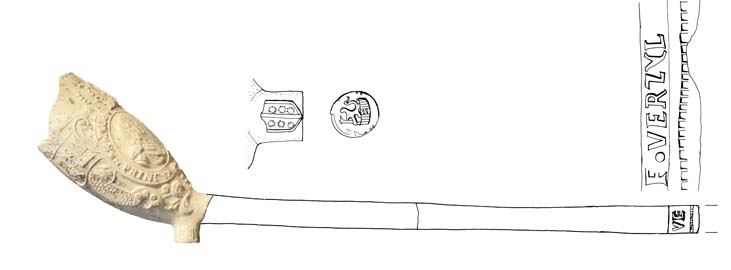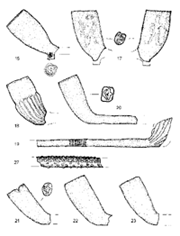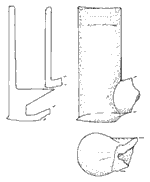|
Michaela Hermann
Tonpfeifenfunde vom Jakobsplatz in Augsburg. Oranier-Pfeifen in Bayern
Erstmals für die ehemalige Reichsstadt Augsburg
wird ein größerer zusammenhängender Fund von Tabakspfeifen
aus einer Ausgrabung vorgelegt. Besonders die Reliefpfeifen mit den Porträts
von Mitgliedern des niederländischen Fürstenhauses Oranien,
die außerhalb der Niederlande selten vorkommen, sind ein bisher
singulärer Fund in Bayern, und es wird daher der Frage nachgegangen,
weshalb diese teuren Rauchutensilien ausgerechnet in der Augsburger Jakobervorstadt,
einem etwas ärmeren Stadtviertel, auftauchen. Möglicherweise
handelt es sich um die Hinterlassenschaft eines (Klein-)Händlers.
Der aus über 800 Fragmenten bestehende Fund datiert relativ einheitlich
ins letzte Drittel des 18. und an den Beginn des 19. Jahrhunderts. Insgesamt
ist eine Dominanz Goudaer Produkte festzustellen, und darunter haben wiederum
die Pfeifen aus der Werkstatt des "Pfeifengiganten" Frans Verzijl
den größten Anteil. Aus seiner Werkstatt stammen auch die oben
erwähnten Reliefpfeifen. Aber auch der zunehmende Import aus dem
Westerwald lässt sich, vor allem anhand eindeutiger Stieltexte, nachweisen.
In manchen Fällen ist es schwierig, niederländische Originale
und Nachahmungen (aus dem Westerwald?) sicher zu unterscheiden. Die Funde
werden in einem ausführlichen Katalog und mit Objektzeichnungen vorgestellt.
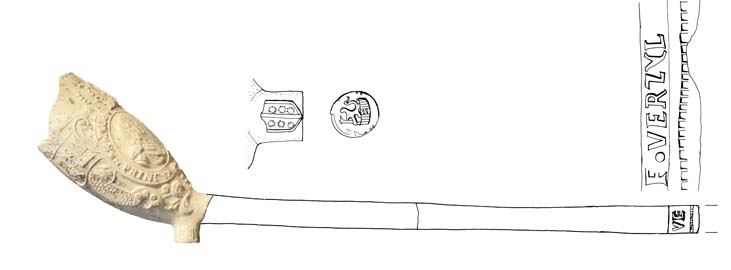
Abb. 3: Augsburg, Jakobsplatz. Reliefpfeife mit dem Porträt von Caroline
von Oranien-Nassau-Dietz, 1760-1765. Gouda. M. 1:1, Marken und Stieltext
M. 2:1.
|
|

Vergrößerung
Abb. 2: Augsburg, Jakobsplatz. 1 u. 2 Reliefpfeifen mit Porträts
von Mitgliedern des Hauses Oranien.
4 Reliefpfeife mit dem Wappen des Königreichs Preußen. 2.
H. 18. Jh. Gouda. M. 1:1.
|