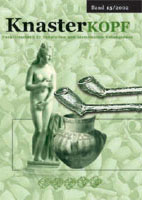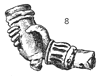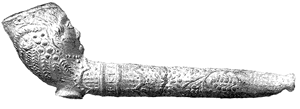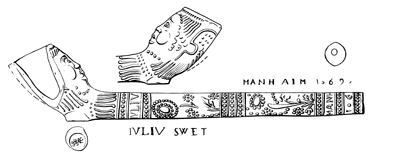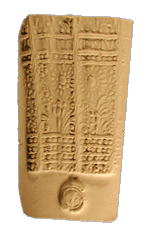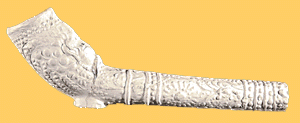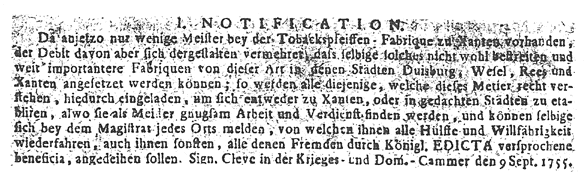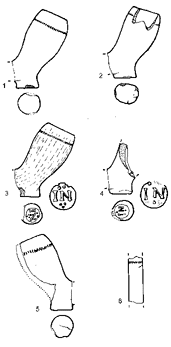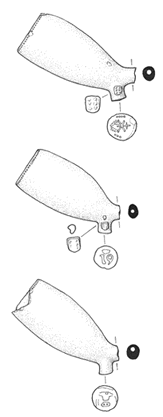Band 15/2002, S. 4f.
Ralf Kluttig-Altmann: Bericht über die 15. Tagung des Arbeitskreises
zur Erforschung der Tonpfeifen vom 28.-30. April 2001 in Grefrath
Die Veranstaltung mit 25 Teilnehmern fand auf Einladung von Heinz-Peter
Mielke im Niederrheinischen Freilichtmuseum Dorenburg in Grefrath statt.
Die Austragung des Treffens im deutsch/belgisch/niederländischen
Grenzgebiet bot Möglichkeit, sich stärker der engen Verflechtungen
bewusst zu werden, die hauptsächlich im 18./19. Jahrhundert in
der heute durch Grenzen getrennten Region auf den Gebieten der Produktion,
Vertrieb und Konsum von Tonpfeifen und Tabak bestanden haben. Unter
diesem Leitthema standen auch die Exkursionen nach Weert/NL (Museum
"De Tiendschuur" und Pfeifenofen der Fa. Trumm-Bergmans) und
Andenne/B (Musée de la Ceramique und Piperie Léonard).
Den vollständigen Text dieses Aufsatzes finden sie hier.

|
|
|
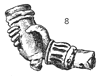
Vollbild
|
Band 15/2002, S. 8-18
Rüdiger Articus: "Rohre gab es immer schon". Zur Geschichte
der Tonpfeifenforschung im 19. Jahrhundert
Anhand vieler Originalquellen gibt der Verf. einen Überblick über
die früher oft gesehene Verbindung von Tonpfeifenfunden mit prähistorischen
oder antiken Fundstellen und den entsprechenden Kulturen. Seit den 1820er
Jahren wurden bei Ausgrabungen an keltischen oder römischen Fundplätzen,
vor allem in Süddeutschland, immer wieder Tonpfeifen gefunden und,
da die älteren Pfeifenformen des 17. Jahrhunderts schon in Vergessenheit
geraten waren, diesen Kulturen zugewiesen. Der Gelehrtenschaft Deutschlands
bzw. Mitteleuropas im 19. und frühen 20. Jahrhundert war der Gedanke
unerträglich, dass eine so allgegenwärtige kulturelle Errungenschaft
wie das Rauchen von den Barbaren Amerikas übernommen worden sein
sollte - hier mussten europäische Wurzeln gefunden werden, am besten
antike! Obwohl man sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts allgemein von
diesem Wunschdenken verabschiedete, finden die alten Gedanken auch heute
noch manchmal Eingang in Ausstellungen, Lexika und andere Publikationen.
Ein in diesem Zusammenhang noch nicht zufriedenstellend gelöstes
Problem sind die ebenfalls seit dem 19. Jahrhundert gefundenen metallenen
Pfeifen, die möglicherweise lokale Nachahmungen der holländischen
Tonpfeifen darstellen.

|
|
Band 15/2002, S. 19-34
Michael Schmaedecke: Floral verzierte Pfeifenstiele aus Südwestdeutschland
und angrenzenden Regionen.
Ansätze zu einer Systematisierung von Produkten vornehmlich
aus dem Raum Mannheim/Frankenthal
In den vergangenen Jahren wurden in Südwestdeutschland und den
angrenzenden Regionen bei archäologischen Untersuchungen zahlreiche
Tonpfeifen mit floral verzierten Stielen gefunden. In der vorliegenden
Untersuchung wird versucht, anhand verschiedener Kriterien (Einfassungen
der Bildfelder, Schriftfelder, Motive etc.) Gruppen zu bilden, denen
auch kleine Fragmente, wie sie in archäologischen Befunden erfasst
werden, zugeordnet werden können.
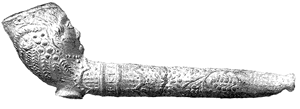
Floral verzierte Tonpfeife von Julius West in Mannheim, dat. 1690er
Jahre
Da die Gruppeneinteilung auf allen Hierarchieebenen erweiterbar ist,
und es sich um ein offenes System handelt, wird es problemlos möglich
sein, noch nicht berücksichtigte weitere Gruppen - auch aus anderen
Materialprovinzen - in das Schema zu integrieren. Im Idealfall - wovon
wir noch weit entfernt sind - soll die Gruppeneinteilung zur Identifikation
bestimmter Pfeifenformen führen.
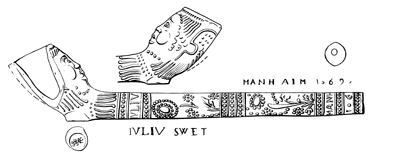
Floral verzierte Tonpfeife von M. Kesselhum

|
|
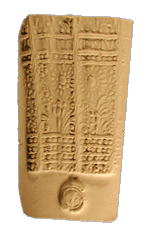
Abrollung des Stieldekors
|
|
Band 15/2002, S. 35-50
Regina Geiß-Dreier: Die Tonpfeifenfunde von Schloss Oberstein
Die auf Schloss Oberstein gefundenen tönernen Tabakspfeifen bezeugen,
dass spätestens ab der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts auch an
der oberen Nahe die Sitte des "Tabaktrinkens" Einzug gehalten
hatte. Das Pfeiferauchen wurde, wie dies auch für andere Burgen belegt
ist, durch die französischen Truppen Ludwigs XIV. während der
Reunionszeit und dem Pfälzischen Erbfolgekrieg eingeführt. Die
Tonpfeifen stammen aufgrund der Namens- und Ortsangaben zum Großteil
aus den Werkstätten pfälzischer Pfeifenbäcker, insbesondere
aus Frankenthal. Dies gilt auch für zahlreiche Pfeifen mit neuen,
bisher nicht identifizierbaren Marken und Initialen. Die Tonpfeifenfunde
aus Idar-Oberstein belegen, dass der Handel mit Tonpfeifen aus dem Raum
Mannheim-Frankenthal nicht nur nach Süden, sondern auch in nördliche
und nordwestliche Regionen stattfand. Mit Schloss Oberstein an der oberen
Nahe kann der bisher nördlichste Fundort kartiert werden.
Die Rundbodenpfeife aus dem Jahre 1736 zeigt, dass auch im 18. Jahrhundert
Tabak auf Schloss Oberstein konsumiert wurde. Die "Wortmann-Pfeife"
belegt den Bezug von Tonpfeifen aus dem Westerwald in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts.
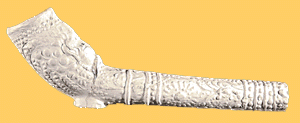
Tonpfeife des Frankenthaler Pfeifenbäckers Otto Kissius mit der Marke
"OK" über einem Dreieck
Offen bleibt bisher die Frage, ob man tönerne Tabakspfeifen auch
aus holländischen Werkstätten importierte. Dies kann erst nach
der Auswertung der noch nicht genauer untersuchten Fundstücke beantwortet
werden. Dazu gehören insbesondere die polierten Tonpfeifenfragmente
und die Einzelstücke mit von der Mehrzahl abweichender Verzierung.
Es ist aber schon jetzt festzustellen, dass sich der Import aus den Niederlanden
auf das 18. Jahrhundert beschränkt.

|
|
Band 15/2002, S. 51-64
Helmut Szill: Tonpfeifenfunde aus Erding. Teil 2
Den Schwerpunkt der Tonpfeifenfunde aus Erding bilden glatte und dekorierte
Pfeifen aus dem 17. Jahrhundert. Neben der großen Vielfalt der
Modelle liegt die Bedeutung der Funde vor allem in der großen
Zahl von Fragmenten mit Initialen. Sie tauchen gleichermaßen als
Marken wie auch als reliefierte Buchstaben an den Seiten des Kopfes
oder der Ferse auf. Zu nennen sind u.a. "TCB", ISC",
"CB", "RV" und "LP" sowie verschiedene
Kombinationen auf einer Pfeife. Bei dieser ersten Materialvorlage ist
es nicht möglich, jedes Modell genauer mit Funden gleicher oder
sehr ähnlicher Stücke zu vergleichen. Es zeigt sich aber deutlich,
dass das Verbreitungsgebiet vorgestellten Pfeifen trotz ihrer vergleichsweise
geringen Qualität sehr groß ist und sich auf den gesamten
südeutschen Raum erstreckt.
Ohne einem archäologischen oder archivalischen Zufallstreffer vorzugreifen,
lässt sich bei derzeitigem Forschungsstand die Provenienz allgemein
nur mit "süddeutsch" benennen. Eine genaue Lokalisierung
der sicher nicht unbedeutenden Produktionsstätte(n?) ist nur über
die Entzifferung der Initialmarken möglich.

|
|
|

Vollbild
|
Band 15/2002, S. 65-71
Natascha Mehler: Tabak und Tonpfeifen in Island im 18. Jahrhundert
am Beispiel der Funde aus Reykjavík, Aðalstræti
Mit diesem Beitrag wird erstmals ein Fundkomplex von Tonpfeifenfragmenten
aus Island vorgestellt und in seinen kulturhistorischen Zusammenhang eingefügt.
In Vergessenheit geratene schriftliche Dokumente belegen, dass man in
Island im 18. Jahrhundert zumindest kurzzeitig erfolgreich Tabak angepflanzt
hat. Tonpfeifen hingegen wurden nicht in Island hergestellt, sondern indirekt
aus Holland, England und Skandinavien über dänische Zwischenhändler
nach Island importiert. Die insgesamt 268 Pfeifenfragmente der Grabung
Reykjavík, Aðalstræti 14-16, wo sich im 18. Jahrhundert
eine Wollfabrik befand, stammen zum größten Teil aus Holland
(Gouda), andere aus Dänemark (Stubbekøbing und København)
und England (Bristol). In Stielumschriften werden sechs Pfeifenbäcker
namentlich genannt: "F.VERSLU" (Franz Verzyl) und "LUCAS
DE IONGE" aus Gouda, "R TIP PET" (Robert Tippet) aus Bristol,
"A·ROSS" (Alexander Ross) und "S·Fe"
(Severin Ferslew) aus Dänemark. Unidentifiziert bleibt der Name "WVVELSEN".

|
|
Band 15/2002, S. 72-78
Heinz-Peter Mielke: Tonpfeifenland Niederrhein. Zur Verbreitung der
Pfeifenbäckerei zwischen Köln und den Niederlanden
Der Niederrhein war stets Absatzgebiet Westerwälder und Niederländischer
Tonpfeifen. Dennoch gab es zwischen Köln und der niederländischen
Grenze immer wieder Versuche, Pfeifenbäckereien zur Versorgung
des lokalen und regionalen Marktes zu etablieren. (Pfeifenbäckerorte
am Niederrhein)
Teils waren diese Versuche erfolgreich, teils nur von geringer Effizienz,
wobei die politischen Verhältnisse den Rahmen für den wirtschaftlichen
Erfolg bildeten. Für die Zeit vom frühen 17. Jahrhundert (Wesel
ab 1638) bis zum Zweiten Weltkrieg (Hoisten) werden 14 Produktionsorte
vorgestellt, unter denen Neuss eine Sonderstellung einnimmt, da Tonpfeifen
dort nur veredelt, d.h. mit einer keramischen Glasur versehen wurden.
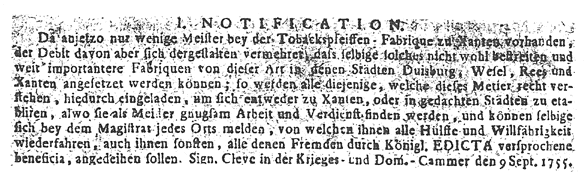
Anzeige der preußischen Kriegs- und Dömänenkammer
zur Ansiedlung von Pfeifenbäckern in niederrheinischen Orten;
aus: Wochentliche Duisburgische Adresse- und Intellegentz-Zettel, 1750er
Jahre

|
|
|
Band 15/2002, S. 79-84
Bärbel Bollinger-Spang/Martin Kügler: Von Tonpfeifen
zu Blumentöpfen aus Ton
Am Beispiel der "Westerwälder Blumentopffabrik Spang
GmbH & Co. KG" in Ransbach-Baumbach/Westerwald wird
aufgezeigt, wie es ein Unternehmen verstanden hat, seine Produktion
von Tonpfeifen rechtzeitig umzustellen und fortzubestehen. Wilhelm
Spang (1876-1952) verließ 1912 die von seinem Vater Johann
Peter Spang I. 1884 gegründete Tonpfeifenfabrik, da der weltweite
Absatzrückgang an Tonpfeifen unübersehbar war und suchte
nach neuen Fabrikationsmöglichkeiten.
|
|

Wilhelm und Christina Spang mit ihren Kindern, ca. 1932
|
|
Mit der Spezialisierung auf die Herstellung von Behältern
aus salzglasiertem Steinzeug für den Haushaltsbedarf und unglasierten
Blumentöpfen aus rot brennendem Ton, vereint mit einer großen
Geschäftstüchtigkeit und technischem Erfindungsreichtum
zur Verbesserung des Produktionsablaufs gelang es ihm, in der wirtschaftlich
schwierigen Zeit von 1918 bis 1945 zu bestehen. Seine Söhne
konnten die Firma seit den 1950er Jahren zum weltweiten fühenden
Hersteller von Blumentöpfen ausbauen.
|

|
|
Band 15/2002, S. 85-89
Ralf Kluttig-Altmann: Richtlinien für das Zeichnen von Tonpfeifen
Die Zeichnung eines archäologischen Fundes soll einem Betrachter
einen Ersatz zur Verfügung stellen, der zwar nicht gleichwertig
sein kann, aber wissenschaftlich relevante Informationen enthält.
Damit eine Zeichnung möglichst viele (optische) Informationen des
Objektes aufnimmt sind Zeichenstandards nötig.
Den vollständigen Text dieses Aufsatzes finden sie hier.

|
|

Einer der ältesten dinglichen Beleg für das Rauchen in Sachsen:
Pfeifenkopf niederländischer Herkunft um 1620
|
|
Band 15/2002, S. 90-95
Martin Kügler: Tonpfeifen aus dem Schönhof in Görlitz
Bei Sanierungsarbeiten wurden in dem historischen Gebäudekomplex
des Schönhofs in Görlitz in der Bodenverfüllung des ersten
Stocks einige Tonpfeifenfragmente aus dem 17. und 18. Jahrhundert gefunden.
Die älteste Tonpfeife ist um 1620 zu datieren und als niederländische
Importware anzusprechen. Das im Fundkontext des Schönhofs singuläre
Fragment ist somit einer der ältesten dinglichen Belege für
das Rauchen von Tabak in Sachsen. Besonders interessant sind vier Fragmente
von Rundbodenpfeifen mit zylindrischem Kopf und stark gebogenem Stiel.
Die Ausformung erfolgte in einer zweiteiligen Pfeifenform ohne eingravierten
Dekor, den der Pfeifenbäcker erst nach dem Herausnehmen aus der Form
manuell aufbrachte. Den Exemplaren aus dem Schönhof entsprechen Tonpfeifen,
die in Breslau/Wroclaw und Zittau in großer Stückzahl ausgegraben
wurden. Es besteht daher Grund zu der Annahme, dass in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts im sächsisch-schlesischen Raum oder in einer
dieser drei Städte eine bedeutende Produktionsstätte existiert
haben muss.
Tonpfeifen aus dem Schönhof in Görlitz mit manuell aufgebrachtem
Dekor am Kopf; Provenienz unbestimmt, zweite Hälfte 18. Jahrhundert.
|
 |
Die stark zerscherbten Fragmente aus dem 18. Jahrhundert sind möglicherweise
Mitglieder der bisher noch nicht bekannten Pfeifenbäckerfamilie Wille
in Frage, die von 1777 bis kurz nach 1830 in Görlitz tätig war.

|
|
Band 15/2002, S. 96
Martin Kügler: Eine Jonas-Pfeife aus dem 18. Jahrhundert
Ein ungewöhnliches Pfeifenmodell ist jüngst in zwei Exemplaren
an verschiedenen Fundorten in Stockholm/S aufgetaucht. Der Kopf zeigt
im Relief ein männliches Gesicht mit starken Augenbrauen, großer
buckliger Nase und langem, geschweiften Schnurrbart und erinnert an
die Jonas-Pfeifen des 17. Jahrhunderts. Die beiden mit der Fersenmarke
"Fuß" bezeichneten Pfeifen tragen auf der linken Seite
der Ferse das Wappen von Gouda. Aufgrund der Kopfform kommt nur eine
Datierung nach ca. 1750 in Frage, mögliche Hersteller sind demnach
Jan Osterhout oder Thomas Verhage. Das Motiv der Jonas-Pfeife ist für
diesen Zeitraum, die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, sehr ungewöhnlich,
da die Produktion dieses Pfeifentyps nach bisherigem Forschungsstand
um 1700 endete.

|
|
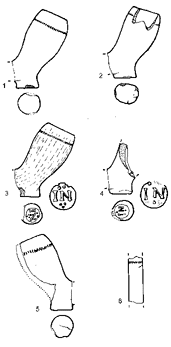
Pfeifenfragmente von John Newall, Cleobury Mortimer, aus der Zeit
von 1680-1710
|
|
Band 15/2002, S. 97 f.
David Higgins: Bericht über die Entdeckung eines Pfeifenofens
bei Cleobury Mortimer, Shropshire/GB
Auf einem Feld der Barnsland Farm, ca. 1,5 km südwestlich von
Cleobury Mortimer, wurden schon 1948 verstreute Tonpfeifenfragmente
entdeckt. Eine Probegrabung 2001 ergab, dass die Stelle ungestört
und das Fundament eines Gebäudes vorhanden war. Es kamen die
Basen von Steinwällen und zahlreiche Reste eines Pfeifenofens
zum Vorschein. Die Funde - Tonpfeifen, Ofenbruchstücke und
Keramik - datieren zwischen 1640 und 1720, die Reste des Pfeifenofens
können genauer auf die Jahre 1680-1710 bestimmt werden. Einige
der Tonpfeifen sind mit "IN" gemarkt. Das Haus und die
Pfeifenbäckerwerkstatt gehörten mit großer Wahrscheinlichkeit
dem auch durch schriftliche Dokumente belegten Pfeifenbäcker
John Newall, der 1719 starb. Sein Testament vom 2. März 1718
oder 1719 ist ebenso erhalten wie das Inventar seines Besitzes vom
11. Mai 1719. Newall gehörte zu den bäuerlichen Handwerkern,
die neben der Landwirtschaft auch ein Gewerbe ausübten und
nur mit seinen Familienangehörigen produzierte. Da in der Umgebung
keine anderen Pfeifenbäcker bekannt sind, wird er in den nahegelegenen
Orten genügend Abnehmer gefunden haben. Seine gemarkten Pfeifen
deuten aber darauf hin, dass er seine Produkte auch auf größeren
Märkten anbot. |

|
|
Band 15/2002, S. 98 ff.
Martin Kügler: Tonpfeifen aus Geelbek/RSA
Auf dem etwa drei Quadratkilometer großen Areal einer riesigen
Wanderdüne bei Geelbek/RSA wurden neben einer großen
Zahl steinzeitlicher Artefakte auch Reste jüngerer Besiedlungen
gefunden. Vorgestellt werden 9 Tonpfeifenfragemente, von denen
nur drei mit Marken versehen sind. Die Tonpfeifen stammen aus
Gouda und wurden um 1750 bzw. in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts hergestellt und nach Südafrika exportiert.
Tonpfeifen niederländischer Herkunft, gefunden in Geelbek/RSA
|
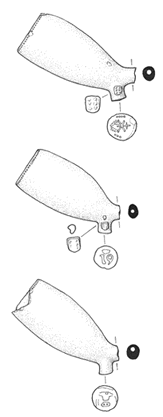 |
|
|
|
|
|