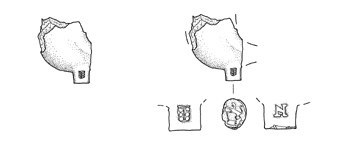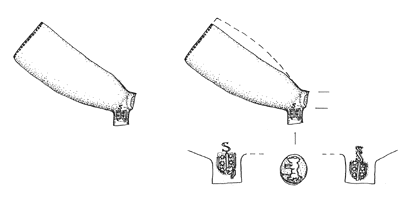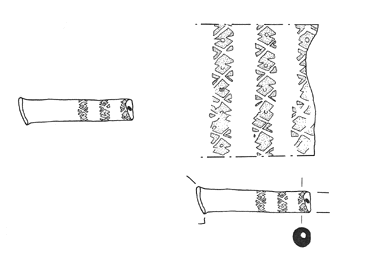1 Einleitung
Die Zeichnung eines archäologischen Fundes soll einem Betrachter,
dem das originale Objekt nicht vorliegt, einen Ersatz zur Verfügung
stellen, der zwar nicht gleichwertig sein kann, aber wissenschaftlich
relevante Informationen enthält. Gegenüber der Fotografie
wird die Zeichnung durch ein höheres Maß an Subjektivität
charakterisiert - was jedoch keinesfalls als Nachteil verstanden werden
muss, sondern mit Gewinn eingesetzt werden kann.
Damit eine Zeichnung möglichst viele (optische) Informationen des
Objektes aufnimmt und diese vom Betrachter komplett verstanden werden
können, sind Zeichenstandards nötig. Die schriftliche Festlegung
solcher Standards ist in der Archäologie aber eher die Ausnahme.
Meist wird nach Erfahrung, ungefähren Richtlinien und der persönlichen
Auffassung des Zeichners gearbeitet. Für das Zeichnen so kleiner
und detailreicher Objekte wie Tonpfeifen versteht der Autor, v.a. als
Mitredakteur und -herausgeber des KnasterKOPF , die
Formulierung von Regeln an dieser Stelle aber als wichtige Voraussetzung,
damit die Zeichnungen den o.g. Informationsanspruch erfüllen und
damit den Erfordernissen einer wissenschaftlichen Zeitschrift gerecht
werden. Jenen Wissenschaftlern, Heimatforschern und Sammlern, die zum
ersten Mal mit dem Zeichnen von Tonpfeifen konfrontiert werden, sollen
diese Richtlinien als Hilfe an die Hand gegeben werden. Wer als Autor
für den KnasterKOPF schreibt, findet hier verbindliche redaktionelle
Vorgaben für seine Zeichnungen.
 2 Ansprache der Tonpfeife
Für die richtige Bezeichnung der Tonpfeife und ihrer typischen
Details gilt die 1987 von Martin Kügler festgelegte Terminologie
(Kügler, Tonpfeifen; ebenfalls in M. Kügler / M. Schmaedecke,
Hinweise), die bereits im KnasterKOPF angewendet wird und sich auch
überregional in der aktuellen wissenschaftlichen Beschäftigung
mit Tonpfeifen durchgesetzt hat.
 3 Anfertigung der Zeichnung
3.1 Richtige Ausleuchtung und Betrachtung der Tonpfeife
Auch der beste Zeichner kann nur so detailliert zeichnen, wie er das
Objekt zu erkennen vermag. Weil Tonpfeifen kleine und häufig schlecht
ausgeprägte Verzierungen bzw. Umschriften besitzen, deren Erkennbarkeit
oft durch ihren Umlauf um den runden Stiel noch erschwert wird, ist
eine optimale Beleuchtung beim Zeichnen unerlässlich. Es empfiehlt
sich, mit starkem Schräglicht von links oben zu arbeiten (dies
ist die in der Archäologie übliche Ausleuchtung beim Fundzeichnen;
siehe auch Kap. 3.5.). Für das Erkennen komplizierter
Strukturen, z.B. undeutlicher Stielumschriften, sollte man das Objekt
unter dem Schräglicht drehen - die Ausnutzung aller Schattenperspektiven
enthüllt auch feinste Reliefunterschiede. Zusätzlich kann
man eine Lupe mit ca. 3-5 facher Vergrößerung zu Hilfe nehmen.
Eine 10fach-Lupe enthüllt zwar noch feinere Oberflächendetails,
ist aber andererseits der zum Zeichnen nötigen Übersicht durch
ihre starke Vergrößerung hinderlich.
 3.2 Bestandteile und Arrangement der Zeichnung
Die aussagekräftigste Ansicht einer Tonpfeife bzw. eines -fragmentes
mit Kopf(ansatz) ist meist eine Seitenansicht (Abb. 1, 2).
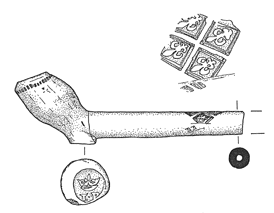
|
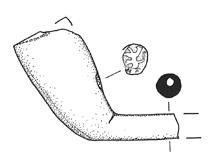 |
Abb. 1) Tonpfeifenfragment mit längerem Stielansatz; angedeutete
Polierstriche am Kopf, die vergrößerte Darstellung
der schräg aufgebrachten Stielverzierung ist ebenfalls so
schräg ausgerichtet.
|
Abb.2) Tonpfeifenfragment mit kurzem Stielansatz; Darstellung einer
Innenmarke, geringe Kopfergänzung.
|
Diese wird auf der Zeichnung grundsätzlich so ausgerichtet, dass
der Kopf nach links und das Mundstück nach rechts zeigen. Dabei
liegt der Stiel horizontal, es sei denn, der Winkel zwischen Kopf und
Stiel ist spitzer als 90°. In diesem Fall wird die Mittelachse des
Kopfes vertikal ausgerichtet (Abb. 3).
Details der Pfeife, die auf der Gesamtansicht nicht sichtbar oder zu
klein sind, sollten noch einmal in Vergrößerung gezeichnet
und dabei nahe ihrer wirklichen Position auf der Pfeife abgebildet werden,
d.h. Fersenmarken unter der Ferse, Stielabrollungen über dem Stiel
usw. (Abb. 1, 2, 5b, 6b, 7b). Besitzt ein Stielfragment
ohne Kopfansatz Umschriften, sollte es im Sinne einer besseren Zeichen-
und Lesbarkeit senkrecht gestellt werden (Abb. 4).
Die Abbildung der Details sollte deren reale Ausrichtung auf der Pfeife
berücksichtigen; ist also eine Fersenmarke oder Stielverzierung
schräg eingedrückt, sollte das auch so dargestellt werden
(Abb. 1). Beim Arrangement mehrerer Zeichnungen auf
einer Tafel sind im Sinne einer optimalen Platzausnutzung auch Abweichungen
von diesen grundsätzlichen Ausrichtungen zulässig.
Ein Stielquerschnitt ist meist sinnvoll, da er die Dicke des Stiels
sowie Durchmesser und Lage des Rauchkanals zeigt. Der Querschnitt muss
nicht wie auf den abgebildeten Beispielen schwarz gefüllt werden,
darf jedoch auch keine Schattierung enthalten, da er nur eine fiktive
und keine wirkliche Ansicht darstellt.
|
|
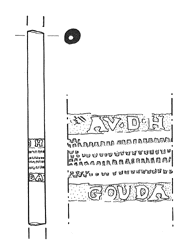 |
Abb. 3) Tonpfeifenfragment mit kurzem Stielansatz; wegen des
spitzen Kopf-Stiel-Winkels gerade Ausrichtung des Kopfes.
|
Abb. 4) Stielfragment mit umlaufender Verzierung; Abrollung ist
nicht an der Überrollstelle aufgeschnitten (linker Teil), sondern
daneben.
|
3.3 Zeichenmaßstäbe
Die Tonpfeife selbst wird im Maßstab 1:1 gezeichnet. Von Details,
die in dieser Größe nicht erkennbar, für die Auswertung
aber sehr wichtig sind, wie Marken, Kopf- und Stielverzierungen, sollten
zusätzlichen Abbildungen im Maßstab 2:1 angefertigt werden.
 3.4 Strichstärken und Linienarten
Mit Bleistift kann eine Vorzeichnung auf weißem Papier angefertigt
werden, deren Umrisse auf ein Transparentpapier übertragbar sind.
Die endgültige Zeichnung, die auch als Vorlage zum Druck dienen
kann, sollte mit Rapidografen auf diesem Transparentblatt ausgeführt
werden. Als Strichstärken haben sich 0,25 mm für den Umriss
der Objekte, 0,18 mm für alle einfachen Details und 0,1 mm für
feinste Details, z.B. kleine Verzierungen, Marken oder Herstellungsspuren,
bewährt.
Zeichnerische Abrollungen von Stiel- oder Kopfverzierungen, die an einer
Stelle ihrer meist ringartigen Form "aufgeschnitten" werden
müssen, werden an diesen Schnittkanten mit einer Strich-Punkt-Linie
(0,25 mm Strichstärke) begrenzt. Diese Linienart wird in der Archäologie
üblicherweise für fiktive, nicht natürliche Grenzen verwendet
(Abb. 4, 7b, 8c).
 3.5 Schattierung
Die Schattierung ist ein wichtiges zeichnerisches Mittel, kann sie doch
dem Betrachter auf dem zweidimensionalen Papier den Eindruck eines dreidimensionalen
Objektes vermitteln. Schattiert wird nur mit Punkten; nicht mehr, wie
in älteren Publikationen üblich, mit Schraffuren. Dabei wird
grundsätzlich ein Lichteinfall von links oben angenommen bzw. tatsächlich
erzeugt, die Schatten fallen dementsprechend vor allem nach rechts unten.
Tieferliegende Partien kann man zum besseren Bildverständnis ebenfalls
durch eine Schattierung hervorheben, auch wenn sie beim angewendeten
Lichteinfall eigentlich ausgeleuchtet sind. Weil Tonpfeifen kleine Objekte
sind, sollte eine Schattierung sparsam eingesetzt werden, um keine Verzierungen
oder Herstellungsspuren zu überdecken.
 3.6 Abreiben als Hilfsmittel
Der halbreliefartige Charakter der meisten Verzierungen auf Tonpfeifen
bietet den Vorteil, dass man Marken oder Stielverzierungen, deren Ausmessen
für die Zeichnung sehr aufwändig wäre, abreiben kann.
Dazu fixiert man ein dünnes Papier über der Verzierung bzw.
dem Stiel und reibt mit einem möglichst harten Bleistift darüber.
Auf dem Papier entsteht ein einfaches Negativ der Verzierung (Abb.
8a). Beim Befestigen des Abreibepapiers ist darauf zu achten, dass
die Stelle, an der die Abrollung notwendigerweise "aufgeschnitten"
werden muss, nach Möglichkeit nicht gerade die für die Fundinterpretation
wichtigen Ansatz- und Überlagerungsstellen der manuellen Verzierungen
stört (Abb. 4 links).
Wichtig ist, dass man diese Abreibung lediglich als ein Zwischenergebnis
begreift, welches mit ganz eigenen Fehlerquellen behaftet ist, die in
einem anschließenden Umzeichnen ausgeglichen werden müssen.
Man kann, um den für Details gewünschten Maßstab von
2:1 zu erreichen, die angefertigte Abreibung auf doppelte Größe
kopieren (Abb. 8b). Auf einem über diese Kopie
gelegten Transparentpapier zeichnet man mit Bleistift die Umrisse nach.
Ein ständiger Vergleich mit dem Originalobjekt stellt sicher, ob
die Abreibung auch wirklich alle Details der Verzierung erfasst hat.
Bei größeren Reliefunterschieden, wie sie z.B. neben Formnähten
oder bei kräftig eingedrückten Verzierungen entstehen, kann
der Abreibestift die danebenliegenden feineren Erhebungen nicht mit
erfassen, die anschließend ergänzt werden müssen. Außerdem
ist der Abreibestift "blind" - er markiert störende Formnähte
oder Kratzer von der Fundbergung ebenso deutlich wie die Verzierung
selbst. Hier ist anschließend wieder der Zeichner gefragt, der
nebensächliche Details abschwächt oder weg lässt und
wichtigere betont (Abb. 8c).
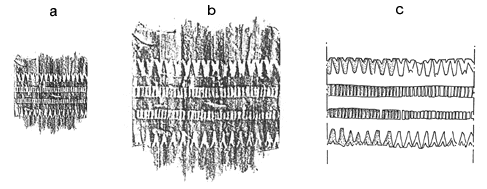
Abb. 8) Von der Abreibung zur Zeichnung einer umlaufenden Stielverzierung.
a: aufgeschnittene Abreibung.
b: vergrößerte Kopie der Abreibung (200%).
c: Umzeichnung der vergrößerten Abreibung;
zu Demonstrationszwecken ist hier nur die linke Hälfte schattiert.
 3.7 Zeichnerische Subjektivität: Ergänzen und Weglassen
Da man es bei den fragilen Tonpfeifen meist mit unvollständig erhaltenen
Stücken zu tun hat, ist es sehr wichtig, dem Betrachter durch eine
angedeutete zeichnerische Ergänzung eine Vorstellung vom ursprünglichen
kompletten Zustand der Pfeife zu vermitteln. Bei Stielfragmenten ist
das einfach - hier gibt es meist nur zwei Richtungen, in die er sich
fortsetzen kann. Bei ausschließlicher Abbildung von Kopf- oder
ähnlich komplexen Fragmenten ist die Vorstellungskraft des Betrachters,
wie das komplette Stück ausgesehen hat, meist überfordert
(Abb. 5a, 6a, 7a). Deshalb sollten fehlende Partien
an Pfeifenfragmenten, z.B. abgebrochene Stiele oder Kopfteile, durch
Fortsetzungsstriche angedeutet werden, soweit der Zeichner sich durch
direkte Vergleichsfunde oder aufgrund seiner allgemeinen Materialkenntnis
der vollständigen Gestalt sicher sein kann (alle Abb., bes. 5b,
6b, 7b). Damit bekommt der Betrachter einen realeren und für
die Beurteilung des Fundes wichtigen Eindruck, wieviel von der eigentlichen
Pfeife für die wissenschaftliche Auswertung noch zur Verfügung
gestanden hat und wie schwerwiegend die Fehlstellen sind.
Kratzer von der Fundbergung oder Klebestellen müssen, solange sie
keine Verzierung o.ä. wesentlich beeinträchtigen, nicht mit
gezeichnet werden, da sie an sich keine relevanten Informationen enthalten,
aber von wichtigen Details ablenken und das Gesamtbild der Pfeife stören
können.
Abb. 5 - 7) Die gleichen Kopf- und Stielfragmente jeweils
ohne (a) und
mit zeichnerischer Ergänzung und vergrößerten Detaildarstellungen
(b).
 4 Anforderungen an Druckvorlagen für den KnasterKOPF
Bei Einhaltung aller angeführten Richtlinien gibt es nur noch wenige
spezielle Anforderungen von redaktioneller Seite. Am vorteilhaftesten
ist es, wenn die Originalzeichnung beim Autor verbleiben und an den
KnasterKOPF gute Kopien geschickt werden - diese lassen sich bei der
Gestaltung des Layouts am besten verarbeiten. Bitte ausschließlich
reinweißes Papier verwenden - das sonst so sinnvolle UWS-Papier
ist als Druckvorlage leider fehl am Platz! Zusätzlich können
Zeichnungen auch als Datei eingeschickt werden - dies bitte vor der
Einsendung genauer mit der Redaktion ansprechen.
Wer viele Abbildungen hat und schon Tafeln selbst zusammenstellen will,
kann das unter Berücksichtigung des Formates des KnasterKOPF (Satzspiegel
23 x 17 cm) gern tun. Dabei ist ein Mindestabstand von 1 cm zum Rand
des Satzspiegels einzuhalten. Abbildungsnummern bitte nicht in die Originaltafel,
sondern handschriftlich in eine beigelegte Kopie oder
Skizze der Tafel eintragen. Sehr lang erhaltene Tonpfeifen, die den
Archäologen zwar freuen, aber den Satzspiegel des KnasterKOPF sprengen,
können u.U. kleiner abgebildet werden - auch dies bitte genauer
mit der Redaktion absprechen.
 5 Schlussbemerkungen
Zeichnungen sind besonders in einer objektbezogenen Wissenschaft wie
der Archäologie ein unverzichtbares Element bei der Publikation
von Forschungsergebnissen und werden aufgrund der ihnen innewohnenden
spezifischen Vorteile in absehbarer Zeit auch durch Fotografie nicht
vollständig ersetzt werden. Schlechte Zeichnungen können die
Qualität auch des besten Textes erheblich mindern. Um einen grundlegenden
Qualitätsstandard der Artikel im KnasterKOPF zu gewährleisten,
behalten sich die Herausgeber vor, Zeichnungen ungenügender Qualität
nicht zum Druck freizugeben. Die Herausgeber des KnasterKOPF sind gern
beratend und vermittelnd behilflich, können aber aufgrund der schon
sehr hohen Arbeitsbelastung selbst keine Zeichenarbeiten übernehmen.
Wer als Autor nach diesen Richtlinien nicht selbst zeichnen kann oder
zeichnen lassen kann, hat immer noch die Möglichkeit, seine Objekte
zu fotografieren. Dass dabei wieder ganz eigene Qualitätsansprüche
eingehalten werden müssen, versteht sich von selbst. Entsprechende
Hinweise zum Fotografieren von Tonpfeifen sind in Arbeit, können
aber bei Bedarf jetzt schon bei den Herausgebern des KnasterKOPF angefordert
werden.

Literatur
Terminologie der Tonpfeife
Kügler, Martin: Tonpfeifen. Ein Beitrag zur Geschichte der Tonpfeifenbäckerei
in Deutschland. Höhr-Grenzhausen 1987, bes. S. 50-54.
ders. / Schmaedecke, Michael: Hinweise für die Erfassung von archäologischen
Tonpfeifenfunden. In: M. Schmaedecke [Hrsg.], Tonpfeifen in der Schweiz,
1999, S. 124-132.
Zeichnungen
Kluttig-Altmann, Ralf: Tonpfeifen in Leipzig - Erster Vorbericht über
die Neufunde seit 1990. In: Knasterkopf - Mitteilungen für Freunde
irdener Pfeifen. Heft 12/1999, S. 74-82.
ders.: Tonpfeifen in Leipzig - Zweiter Vorbericht über die Neufunde
seit 1990. In: Knasterkopf - Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen.
Heft 13/2000, S. 10-28.
ders.: Beobachtungen zur Technologie manueller Stielverzierungen an
Tonpfeifen. Mit einem Beitrag von M. Kügler. In: Knasterkopf -
Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss. Heft
14/2001, S. 32-49.
Zeichnungen
Abb. 6a/b Frau H. Groß, Landesamt für Archäologie Dresden;
sonst Verfasser.
|