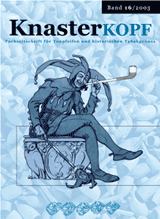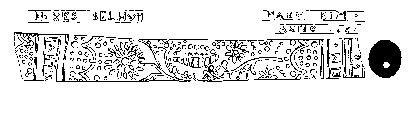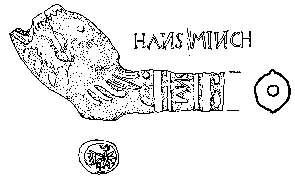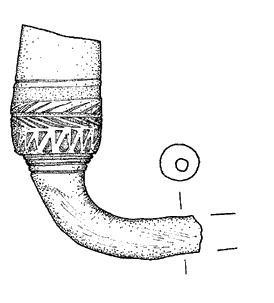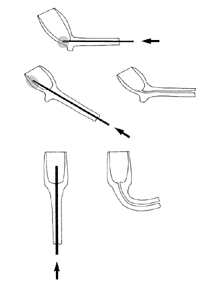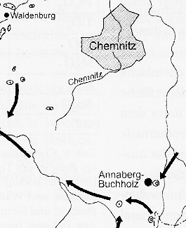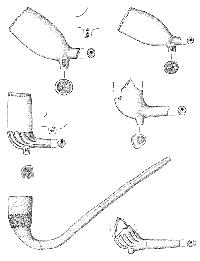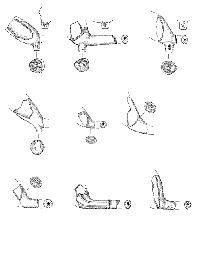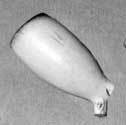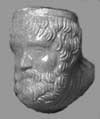Band 16/2003, S. 180-189
Richard Gartley: Deutsche "Stummelpfeifen" von Ausgrabungen
in den USA
In einem breit angelegten Überblick werden Funde
von Gesteckpfeifenköpfen aus dem 19. Jahrhundert vorgestellt, die
von Großalmerode und Uslar in die USA exportiert wurden. Dabei sind
neben allgemeinem Darstellungen (Philosoph, Herkules, Frauenkopf, Türke)
vor allem die Porträtpfeifen amerikanischer Politiker und Präsidenten
von Interesse. Sie können auf wenige Jahre genau datiert werden,
da die Popularität der Pfeifen von der Kariere der Politiker abhängig
war. Dabei ist der bisherigen Ansicht zu widersprechen, solche Pfeifen
seien bevorzugt von Sklaven geraucht worden.

Philosophenkopf aus der Töpferei John Tabor in East Alton, New
Hampshire
Belegt werden kann die Produktion solcher Pfeifen durch
amerikanische Fabriken, die in Ohio, New Hampshire und Virginia ansässig
waren. Die einheimische Produktion war zwar qualitativ schlechter, doch
konnten die Hersteller die Störungen des Welthandels infolge des
amerikanischen Bürgerkrieges für sich nutzen.
|
|
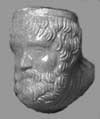
Glasierter Gesteckpfeifenkopf aus Großalmerode mit dem Porträt
eins antiken Philosophen, gefunden in Fort Sanders, Wyoming

Porträtpfeife von Frank Pierce, 1853-1857 amerikanischer Präsident,
gefunden in San Juan Island
|